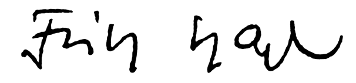EINF?HRUNG
Von Fritz Hagl
 40 Malerjahre auf der Insel haben mich zu meinem Thema gebracht, das heute in vielen Abwandlungen ausgef?hrt meine Malerei ausmacht.
40 Malerjahre auf der Insel haben mich zu meinem Thema gebracht, das heute in vielen Abwandlungen ausgef?hrt meine Malerei ausmacht.
In den ersten Jahren, nachdem ich mein Haus gebaut hatte, eroberte ich durch Zeichnungen vor der Natur die vielgestaltige Formenwelt von Elba, den Blick schon sehr auf fein strukturierte Details gerichtet. Die Str?nde waren eine wahre Fundgrube ? ein Kosmos aus Kombinationen ? man musste nur hinsehen und sie in die entsprechende Ordnung bringen. Ich fand dass die Welt aus lauter Details besteht, die das Gro?e Ganze schon in sich tragen.
Das vom Meer umschlossene St?ck Erde, auf dem ich nun richtig lebte, der eingeschr?nkte Bewegungsradius, die Zur?ckgezogenheit, ja fast Isoliertheit in den 60er und 70er Jahren lenkten meine Aufmerksamkeit auf das vorhandene, ungestaltete naturhafte , und das war mein Material, das ich immer mehr in meine Arbeit integrierte.
Diese Natur wurde mein Lehrer, und ich begr??te diese Lehre: war ich doch bereit, von Neuem zu beginnen.
Da ich Maler bleiben wollte, habe ich organische Geflechte und Mineralien nicht stofflich in meine Bilder installiert, sondern sie als Ausgangsformen schabloniert oder als Abdruckst?cke verwendet. Es war ein fortschreitender Prozess, von der vorgefundenen Form ausgehend ?ber die ganze Bildfl?che weiter fortzumalen, fast spielerisch, ohne vorgefasste Idee, aber konzentriert die Arbeit voranzutreiben. Dieses Geschehen ist ein sehr gl?ckhaftes, da es mir auch Geborgenheit und Selbstvertrauen gab, und ich hatte gar keinen Zweifel, dass mein Treiben gut und berechtigt war.
Das Endergebnis als Ziel interessierte mich nur wenig, der Vorgang selbst hatte mich ganz im Griff. Was sich an Einf?llen w?hrend der Arbeit ergab konnte ich gleich umsetzen, auf die gro?en Ideen lie? ich mich gar nicht ein. Ich entdeckte, dass sich w?hrend des Malens eine Menge Ideen als jeweilige Antwort auf mein Tun einstellten, und ich ging mit dieser Art Dialog solange weiter, bis der lebendige Fluss abbrach und ich sp?rte, dass ich die Arbeit an dem Bild f?r den Moment ruhen lassen musste. Da es viele vorbereitete Bildtr?ger gab, konnte ich an einer anderen Tafel weitermachen und den Energieschub von der letzten Arbeit mit hin?bernehmen, musste also nicht immer neu erfinden. Ich gew?hnte mich daran, mehrere Bilder zugleich in Arbeit zu haben, das verhindert ein zu langes malen an einem Bild, was zu st?ndigen ?bermalungen f?hrt, zu einem Massengrab an ungel?sten Zust?nden, einem fest verschn?rtem Malertagebuch von dem nur noch der Umschlag existiert.
Ich habe eine Reihe von Schinken aus meiner vor-Elba-Zeit ? meistens ertrinken sie in ?l, haben keine Transparenz und kein Licht mehr. Ich bin f?rs offene Tagebuch, und in meinem Atelier stehen Arbeiten, die ich als Zust?nde bezeichnen w?rde ? ungel?st erschienen sie mir schon damals, als sie entstanden. Ich habe sie so gelassen, eben so gut ich konnte, und sie strahlen und sind in ihrer Offenheit eine st?ndig neue Quelle der Inspiration. Da meine Bilder einen transparenten, lasierenden fast aquarellartigen Farbauftrag haben, lege ich gro?en Wert auf ganz helle Gr?nde und Temperauntermalungen. Das tut meinen Farben sehr gut: sie bekommen das Licht aus der Tiefe, die deckenden formgestalterischen Aufmalungen schweben vor dem Betrachter und bewegen sich nach vorne aus der Bildfl?che heraus. Es entsteht eine Art Schichtperspektive, die, wenn k?hle und warme T?ne nebeneinander stehen, auch mal in leichte Bewegung ger?t. So ein Bild geht, im wahrsten Sinne des Wortes, auf den Betrachter zu.
Im Laufe der Zeit entdeckte ich neue M?glichkeiten des Bildaufbaus, indem ich chaotisch zu nennende Zwischenzust?nde erzeugte, die ich im Laufe der Arbeit immer mehr ordnete, durchgestaltete und so, aus einem anregenden Rohling, zu meiner Bildform fand. Da es kaum Verbindungen nach drau?en gab: keine Ausstellungen, keine Informationen ?ber Kunst, war ich ganz auf mich angewiesen, und mir war jedes Mittel recht, um mir Mut zu machen, weiterzumalen, und bei dieser Gradwanderung nicht abzurutschen.
Es war anfangs auch nicht einfach, meinen pers?nlichen Rhythmus zu finden. Da war nicht nur die Malerei ? in unserem gro?en Garten und an den H?usern gab es genug zu tun ? und ich musste herausfinden, wann ich f?r was gut war. Da sich meine rohen Kr?fte morgens austoben wollten, war das die Zeit zum H?user bauen, B?ume f?llen, umgraben?
Ab 15 Uhr, leicht angem?det, wurden meine Sinne f?r das Feinere wach. Ab da war dann Malzeit. Aus Erfahrung, wusste ich, dass ich morgens, nach der Aktivit?tspause der Nacht, nicht ins Atelier gehen durfte, meine zupackende Art tat den Bildern gar nicht gut. Erst nachmittags kam ein kontemplativer Zustand ?ber mich, der mich an vorangegangenes ankn?pfen lies und meiner Malerei h?chst zutr?glich war. Ich war meiner Freiheit und meiner Unabh?ngigkeit dankbar f?r dieses Privileg, meine Zeit selbst gestalten zu d?rfen.
Meine Bilder haben keine Titel; dadurch hat der Betrachter die Freiheit, unbeeinflusst die Ihm entsprechende Interpretation und Seinen eigenen Platz im Bildgeschehen zu entdecken. So nimmt er Anteil an meiner Arbeit und sorgt f?r ihr lebendiges Weiterleben.